3D Fernsehen
Räumliches Sehen
Räumliches Sehen entsteht erst im Gehirn des Betrachters: Auf der Netzhaut jedes Auges entsteht ein Abbild dessen, was der Mensch anblickt. Der Abstand zwischen den Augen führt zu verschiedenen Blickwinkeln. Das Gehirn fügt nun die leicht unterschiedlichen Sinneseindrücke beider Augen zu einem dreidimensionalen Bild zusammen. Dadurch sind wir zum Beispiel in der Lage, Entfernungen zwischen verschiedenen Objekten einschätzen.
Um nun ein 3D-Bild zu erzeugen, wird das Gehirn überlistet, indem man uns zwei leicht unterschiedliche Bilder desselben Motivs zeigt, die dann im Gehirn zu einem dreidimensionalen Bild zusammengeführt werden.
Aus 2D wird 3D
Moderne Blu-ray Player und 3D-Fernseher sind heute in der Lage herkömmliche 2D-Filme dreidimensional aussehen lassen. Die Tiefenwirkung reicht jedoch zumeist nicht an die von echten 3D-Filmen heran. Wie gut das wirkt, hängt von der Berechnung und auch vom Ausgangs-Filmmaterial ab.
Hintergrund
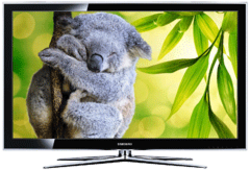
Die Technik zur dreidimensionalen Darstellung von Bildern ist bereits seit fast 200 Jahren bekannt. Aber erst am 27. September 1922 wurde der erste Langfilm in Rot-Grün, „The Power Of Love“ vorgeführt. Als das Kino in den 50ern die erste Krise erlebte, hoffte man, mit dem 3D-Film die Menschen wieder in die Kinos locken zu können.
Doch die 3D-Filme der 50-80er Jahre kommen über die reine Effekt-Hascherei nicht hinaus. Sie beschränken sich auf die Illusion, den Betrachter von der Leinwand aus mit Gegenständen zu bewerfen oder ihm Fahrzeuge entgegenzuschicken. Außerdem war die analoge Technik noch so unpräzise und fehleranfällig, dass die Zuschauer schnell müde wurden, Kopfschmerzen bekamen und manchen sogar übel wurde.
In den letzten 10 Jahren hat sich die Technik für Heimkinos rasant weiterentwickelt – darunter leiden natürlich die traditionellen Spielfilmhäuser. Und wieder einmal, wie in den 50er Jahren, erhofft man sich von der 3D-Technik die Rettung der Kinos. Aufgrund wesentlich besserer Technik erhofft man sich den endgültigen Durchbruch und natürlich auch wieder mehr Zuschauer in den Kinos.
Empfang / Verfügbarkeit
Derzeit gibt es in Deutschland nur wenige Möglichkeiten, 3D-Filme abzuspielen. Fernseher und Abspielgeräte beherrschen zwar die Technik, es mangelt jedoch an Inhalten.
Die meisten Filme sind aktuell auf Blu-ray erhältlich. Außerdem senden einige TV-Sender (zum Beispiel der Bezahlsender sky) ausgewählte Programme, zumeist Sportübertragungen, bereits in 3D.
Technik
Wie oben beschrieben, entsteht der 3D Effekt durch die Darstellung von leicht unterschiedlichen Bildern für das jeweils einzelne Auge. Dafür haben sich derzeit zwei Techniken bewährt: Die eine funktioniert mit Polarisationsbrillen und die andere mit Shutterbrillen.
Polarisationsbrillen nutzen die Tatsache, dass Lichtwellen unterschiedlich schwingen, mal links gedreht, mal rechts. Durch die unterschiedlichen Polarisationsfilter in den beiden Brillenhälften kommt nur das Licht einer Schwingungsebene durch. Während der Film also nun bis zu 200 Mal pro Sekunde zwischen den Bildern für das linke und das rechte Augen wechselt, baut das Gehirn, dank der Polarisationsbrillen, wie beim natürlichen Sehen das Ganze zu einem Raumeindruck zusammen.
In den Shutterbrillen stecken LCD-Schirme, deren elektronische Steuerung sie in sehr präzisem Wechsel mal auf transparent, mal auf undurchsichtig schaltet. Erscheint auf dem Bildschirm ein Bild für das linke Auge, macht die rechte Brillenseite zu und umgekehrt. Gesteuert wird das durch ein Infrarotsignal des Fernsehers. Eine Shutterbrille ist auf eine Stromversorgung, in der Regel in Form von Akkus, angewiesen. Das macht die Brillen schwerer und unbequemer.